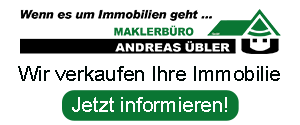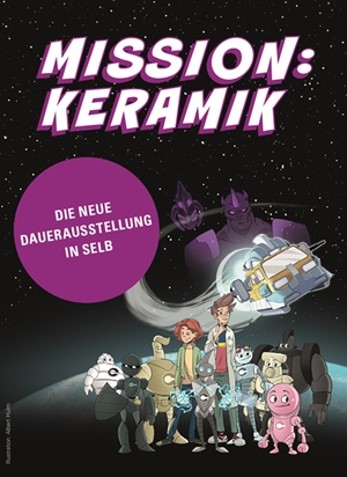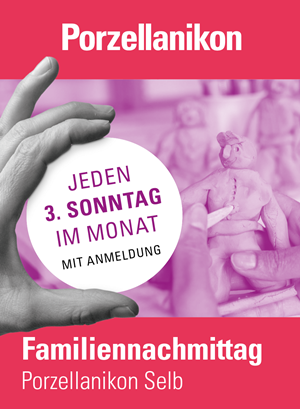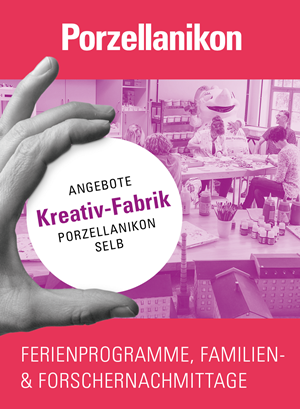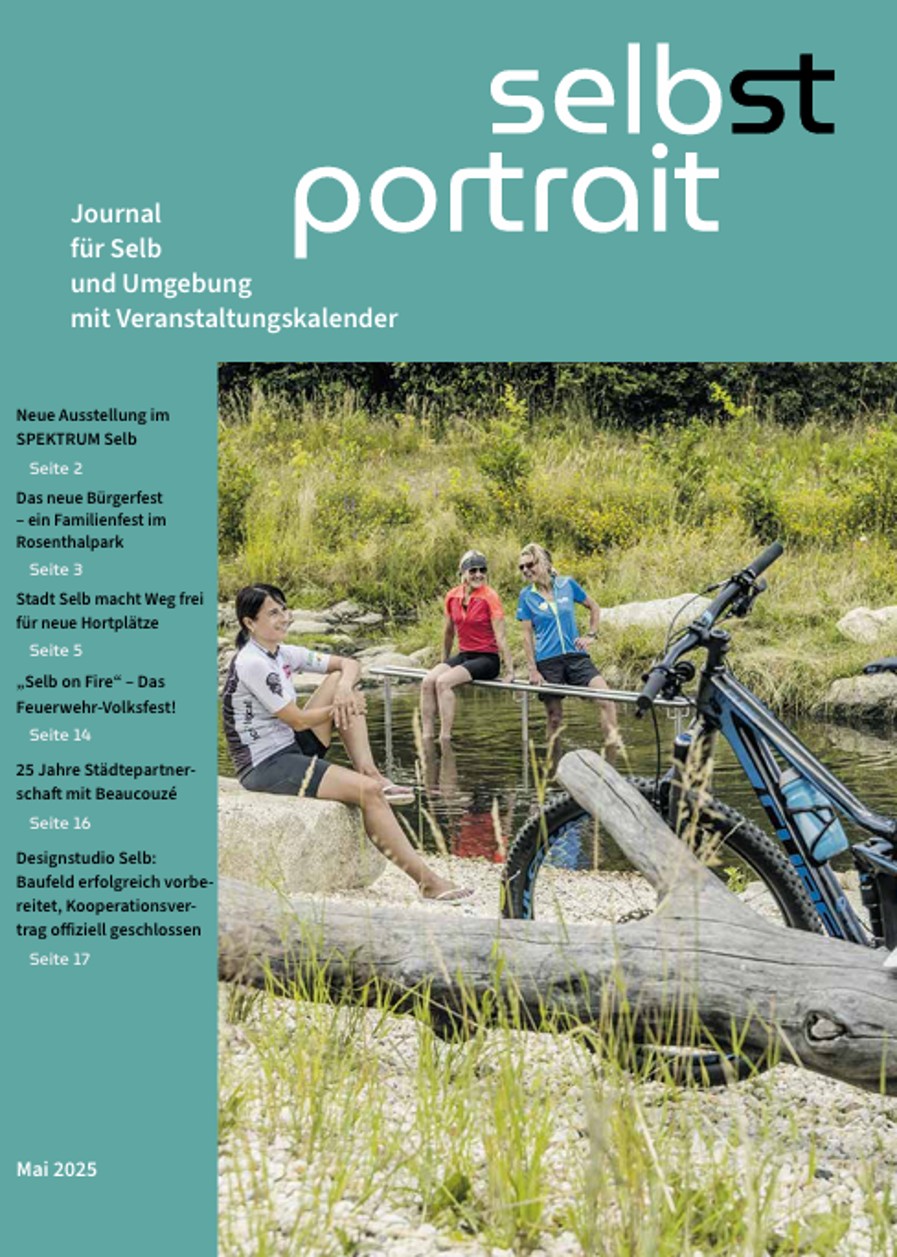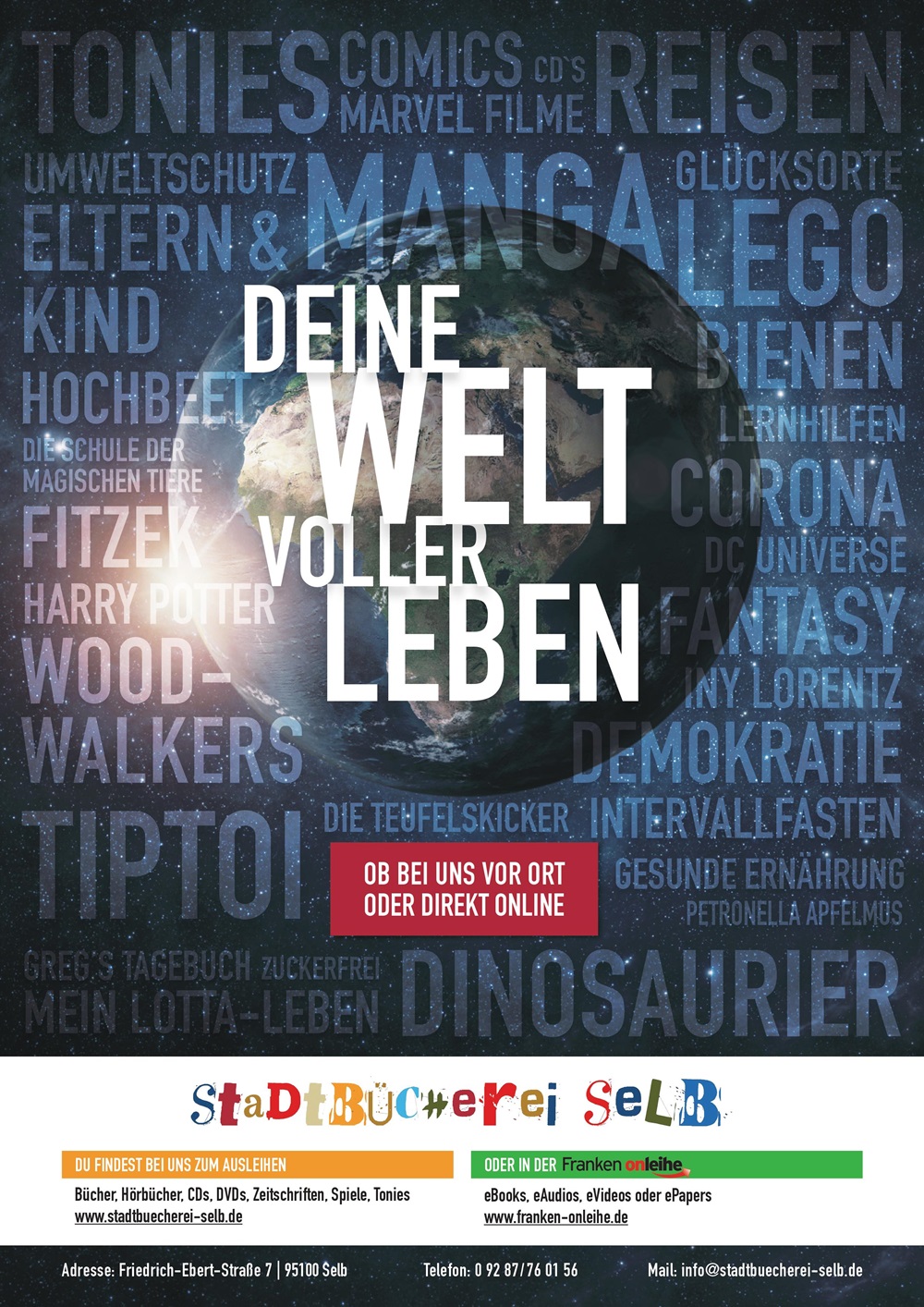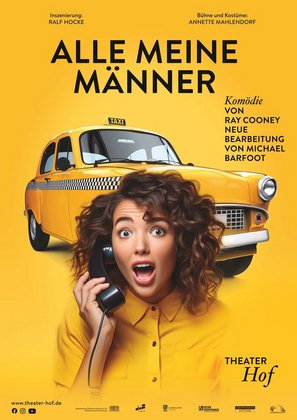17.9.2019 – Traditionsgemäß findet der Pädagogische Tag am Walter-Gropius-Gymnasium immer am ersten Montag im neuen Schuljahr statt. Zentrale pädagogische und didaktische Themen werden bearbeitet, wichtige Impulse für die Unterrichtsarbeit und die Interaktion zwischen Schüler und Lehrkraft in den nächsten Monaten werden gegeben.
17.9.2019 – Traditionsgemäß findet der Pädagogische Tag am Walter-Gropius-Gymnasium immer am ersten Montag im neuen Schuljahr statt. Zentrale pädagogische und didaktische Themen werden bearbeitet, wichtige Impulse für die Unterrichtsarbeit und die Interaktion zwischen Schüler und Lehrkraft in den nächsten Monaten werden gegeben.
An diesem Fortbildungstag ist dem Kollegium schnell klar: Der Referent, Professor Johannes Leisen, ist sehr eloquent und engagiert, die Themen Schule und Bildung liegen ihm wirklich am Herzen. Der Schulleiterin OStDin Tabea-Stephanie Amtmann ist es gelungen, zum Komplex „Binnendifferenzierung und Umgang mit Heterogenität“ eine wirkliche Koryphäe nach Selb zu holen. Leisens Vita, die unter anderem Tätigkeiten als ehemaliger Leiter des Studienseminars für das Lehramt an Gymnasien in Koblenz und eine Professur für Didaktik der Physik umfasst, ist beeindruckend, die Liste seiner Veröffentlichungen lang.
Eingangs werden als Antwort auf die Frage „Was macht guten Unterricht aus?“ vier Faktoren gesammelt, die für das Gelingen entscheidend sind. Eine kognitive Aktivierung, so Leisen, müsse stattfinden, insbesondere was die Aufgabenstellungen anbelangt; außerdem seien Klarheit und Strukturiertheit im Unterrichtsablauf von zentraler Bedeutung. Für ein lernförderliches Unterrichtsklima seien zudem Wertschätzung und Respekt unabdingbar. Schließlich müsse durch entsprechende Rückmeldung und Feedbackgespräche der Lernprozess für den Schüler sichtbar gemacht werden.
 Doch was tun, wenn der Lernende nicht will? Beim Thema „Wollen und Können“ ging Leisen auf die Erkenntnisse der Motivforschung ein. Es sind drei Grundmotive, die für jeden von uns prägend sind: Zugehörigkeit, Erfolg und Autonomie, die jeweils durch Wünsche, aber auch durch Befürchtungen bestimmt sind. Bei jedem Schüler sind sie völlig unterschiedlich ausgeprägt: Während für den einen hauptsächlich die Zugehörigkeit zur Klassengemeinschaft zählt, gute Noten für ihn aber nur eine untergeordnete Rolle spielen, kommt ein anderer mit seiner Stellung als Einzelgänger gut zurecht, ihm ist aber schulischer Erfolg wichtig. Um die Diversität zu unterstreichen, gebraucht Leisen den Terminus „Motiv-Cocktail“, dem sich die Lehrkraft beim Betreten des Klassenzimmers gegenübersieht. Leisens Ansatz lässt sich so zusammenfassen: „Man kann Lernende nicht motivieren, aber man muss an ihre Motive herankommen.“
Doch was tun, wenn der Lernende nicht will? Beim Thema „Wollen und Können“ ging Leisen auf die Erkenntnisse der Motivforschung ein. Es sind drei Grundmotive, die für jeden von uns prägend sind: Zugehörigkeit, Erfolg und Autonomie, die jeweils durch Wünsche, aber auch durch Befürchtungen bestimmt sind. Bei jedem Schüler sind sie völlig unterschiedlich ausgeprägt: Während für den einen hauptsächlich die Zugehörigkeit zur Klassengemeinschaft zählt, gute Noten für ihn aber nur eine untergeordnete Rolle spielen, kommt ein anderer mit seiner Stellung als Einzelgänger gut zurecht, ihm ist aber schulischer Erfolg wichtig. Um die Diversität zu unterstreichen, gebraucht Leisen den Terminus „Motiv-Cocktail“, dem sich die Lehrkraft beim Betreten des Klassenzimmers gegenübersieht. Leisens Ansatz lässt sich so zusammenfassen: „Man kann Lernende nicht motivieren, aber man muss an ihre Motive herankommen.“
In diesem Zusammenhang sieht Leisen den Unterrichtenden als einen Anwalt des Lernens, der sich immer die Frage stellen muss, wie das Lehren auf das Lernen wirkt, und der wissen muss: Das Lehren steht im Dienste des Lernens. Eindrücklich warnt er vor dem verbreiteten Lehr-Lern-Kurzschluss: „Was gelehrt wird, wird gelernt.“ – In der Realität ein Trugschluss!
Für die Situation, dass ein Schüler nicht will, gibt er konkrete Hilfestellungen.
Statt Du-Botschaften auszusenden, sind die Pädagoginnen und Pädagogen in ihrer beobachtenden und beschreibenden Rolle gefragt. Eine eher neutral gehaltene Aussage „Mir fällt auf, dass du in letzter Zeit weniger im Unterricht mitgemacht hast.“ könnte eine Wertung – „Du musst mehr lernen.“ – ersetzen.
Dass Drohungen und Herabsetzungen kontraproduktiv sind, versteht sich von selbst. Leisen empfiehlt stattdessen ein Eingehen auf die Motive des Schülers, die zum Beispiel einer Unterrichtsstörung zugrunde liegen. Dem Schüler Alternativen und Hilfestellungen anbieten, von ihm aber auch einfordern, dass er eigene Vorschläge zur Veränderung der Situation nennt – dies sind weitere Möglichkeiten im Umgang mit fehlender Motivation.
Dass mangelndes Wollen oft mit einer Unter- oder Überforderung einhergeht, macht Leisen im Folgenden deutlich. Zu diesem Zweck schlüpft das Kollegium des WGG in die Schülerrolle. Der Auftrag: Ein Experiment zur Volumenberechnung, das den Anwesenden per Video gezeigt wird, soll in einer Fremdsprache beschrieben werden. Nach dem ersten Satz wird schnell klar: Das funktioniert nicht, es fehlt am Wortschatz – Überforderung macht sich breit.
Im Plenum werden mögliche Hilfestellungen erarbeitet, die eine demotivierende Überforderung bei dieser Aufgabe vermeiden. Die Bereitstellung von entsprechendem Fachvokabular, Formulierungshilfen und die Vorgabe einer strukturierten Gliederung beim Beschreiben könnten dazu beitragen, dass aus Unter- oder Überforderung eine kalkulierte Herausforderung wird. Dem Schüler wird auf diese Weise etwas zugemutet, aber auch etwas zugetraut; mit Anstrengung wird er es schaffen, die nächste Stufe auf seiner Lerntreppe zu erreichen. Leisen warnt an dieser Stelle vor einer „Homogenisierung nach unten“, eine Absenkung des Niveaus will er auf jeden Fall vermeiden. Stattdessen könne mit einer „Heterogenisierung nach oben“ erreicht werden, dass alle auf hohem Niveau besser werden.
Im Feedback wird die Fortbildung mit Professor Leisen vom Kollegium durchweg positiv beurteilt. „Ein wichtiger Input, der unbedingt weitergedacht werden soll.“ – so lässt sich das Ergebnis auf den Punkt bringen. Und die Schulleiterin wünscht sich für die Zukunft, dass auch die Elternschaft Leisens Ausführungen zum Thema Motivation kennenlernt.
selb-live.de – Presseinfo Walter-Gropius-Gymnasium Selb