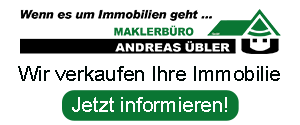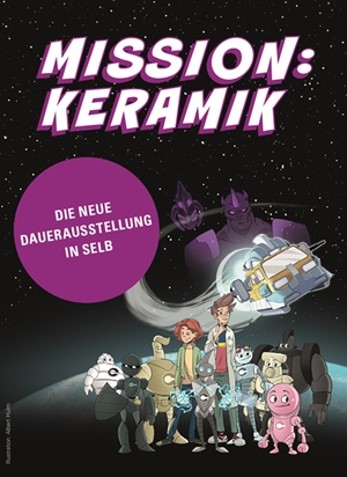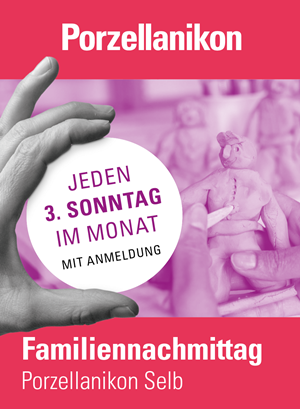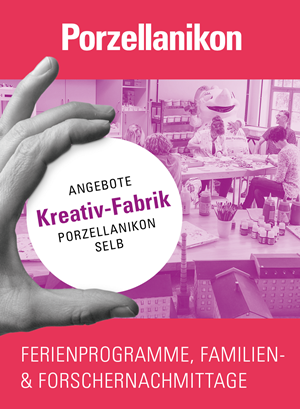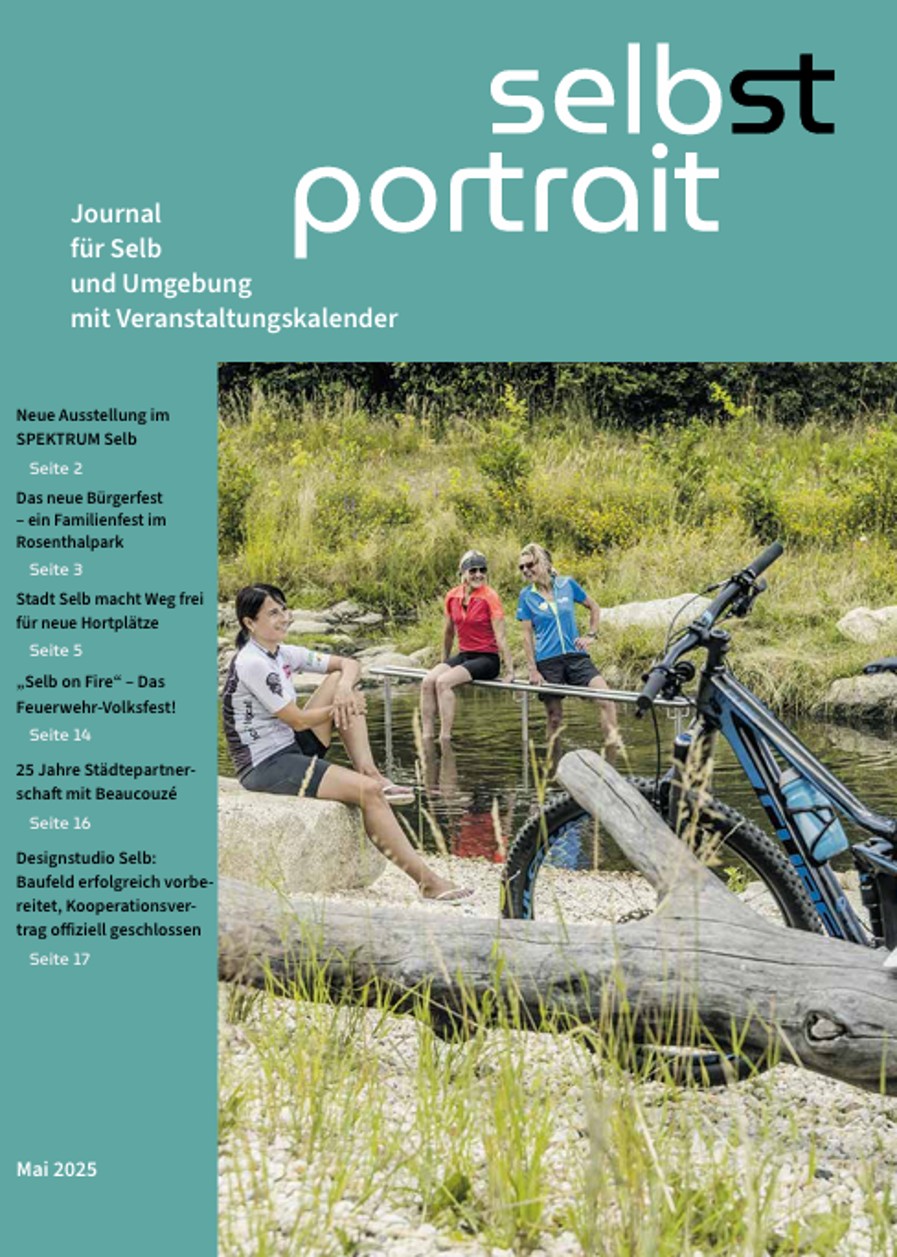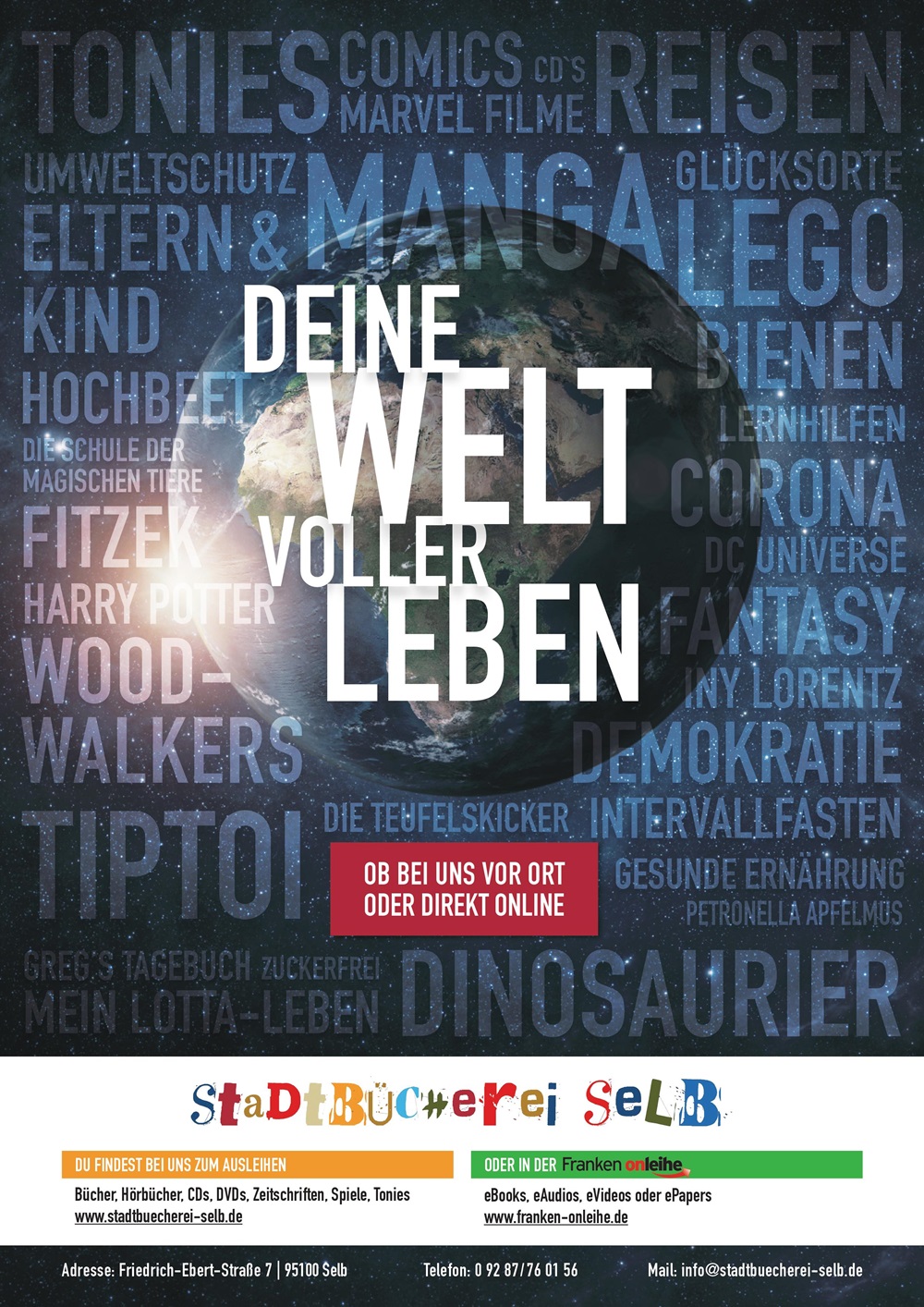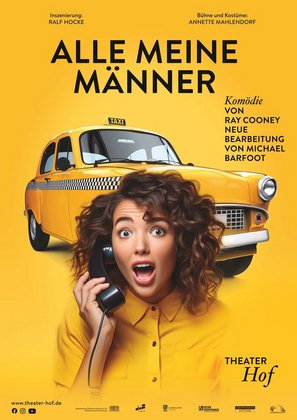22.4.2025 - Warum soll man am Palmsonntag Palmkätzchen verschlucken und am Gründonnerstag gelegte Eier übers Hausdach werfen? Warum am Karfreitag Wirtshäuser meiden und in der Osternacht Osterfeuer anzünden? Zu solchen Bräuchen gab es am Ostermontag eine Kanzelrede des bekannten Heimatforschers Dr. Adrian Roßner aus Bayreuth zum Thema „Fasten- und Osterbräuche im Fichtelgebirge“ auf Einladung der evangelischen Kirchengemeinde Erkersreuth.
22.4.2025 - Warum soll man am Palmsonntag Palmkätzchen verschlucken und am Gründonnerstag gelegte Eier übers Hausdach werfen? Warum am Karfreitag Wirtshäuser meiden und in der Osternacht Osterfeuer anzünden? Zu solchen Bräuchen gab es am Ostermontag eine Kanzelrede des bekannten Heimatforschers Dr. Adrian Roßner aus Bayreuth zum Thema „Fasten- und Osterbräuche im Fichtelgebirge“ auf Einladung der evangelischen Kirchengemeinde Erkersreuth.
Roßner bot in der Kirche Zum Guten Hirten Information aus erster Hand, forscht der junge Historiker doch ausgiebig seit vielen Jahren zu Heimatgeschichte, Volkskunde und Brauchtum der Region.
Über hundert Gottesdienstbesucher feierten einen festlichen Gottesdienst, den Organist Gerhard Kießling musikalisch gestaltete. Adrian Roßner präsentierte sich bei seiner vergnüglichen Kanzelrede in dem von Pfarrer Dr. Jürgen Henkel geleiteten Festgottesdienst in Bestform und sorgte auch für viel Heiterkeit. Das von Pfarrer Henkel angekündigte „Osterlachen“ – auch ein alter christlicher Brauch – war immer wieder laut und deutlich zu hören. Roßner legte dabei auch ein Bekenntnis für den christlichen Glauben und dessen Werte als gesellschaftserhaltend und –verbindend ab.
Zunächst traf er einige grundlegende Feststellungen zum Thema Christentum und Brauchtum. So meinte er: „Der Volksglaube ist ein Kernstück der christlichen Frömmigkeit, die dem Christentum nicht entgegensteht. Es gibt keinen Gegensatz zwischen dem christlich geprägten religiösen Brauchtum und dem christlichen Glauben. Das hat die Brauchtumsforschung in den letzten Jahren wieder herausgearbeitet.“ Wichtig sei im Blick auf das christliche Brauchtum immer „der Bezug zur Natur und zu dem, was man in der Natur als Schöpfung wahrnimmt“.
Beim christlichen Brauchtum sei für jeden etwas dabei. „Jeder hat die Freiheit auszuwählen, nicht jeder kann mit jedem Braucht etwas anfangen. Das Brauchtum gibt aber Halt und zeigt, dass die eigene Machtlosigkeit etwa im Blick auf die große Politik nicht immer entscheidend ist, wenn wir selbst Halt haben im Leben. Viele dieser Dinge im Brauchtum sind nicht logisch, nicht beweisbar, aber es hilft.“ Er selbst habe bei einer Prüfung einmal das unerwartet positive Resultat subjektiv auf ein Paar neuer Socken an diesem Tag zurückgeführt, die für ihn zu „Glückssocken“ wurden.
Anschließend demonstrierte Roßner an vielen praktischen Beispielen den religiösen Gehalt und die Formen der Bräuche, beginnend mit dem Schmücken der Quellen und Brunnen zur Osterzeit. „Das war lange Zeit passé, auch weil sich keiner mehr die Mühe gemacht hat. Jetzt werden Brunnen und Quelle wieder immer öfter schön geschmückt. Das ist ein Dank dafür, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir so viele Brunnen und Quellen haben, aus denen Wasser heraussprudelt, das wir zum Leben brauchen.“
Am Palmsonntag war es unter anderem Brauch, geweihte Palmkätzchen zu verschlucken. „Das sollte gegen Heiserkeit und Halsschmerzen helfen.“ So mancher habe diese dann  vorher in Schnaps eingelegt, dann sei das etwas leichter gefallen. Am Gründonnerstag war es Brauch, dass Menschen Wasser aus Brunnen in die Kirche mitbringen, das dann als „geheiligtes Wasser“ gesegnet wurde. Kinder brachten dann das Wasser mit nach Hause und der Hausvater besprengte damit die Hauswände. Dies sollte dem Haus und der Familie Segen bringen. Auch sollte es dann viel „grünes Essen“ geben. „Das verspricht immer genug Geld, Schutz vor Krankheiten, insbesondere Fieber, Heiserkeit und Müdigkeit.“
vorher in Schnaps eingelegt, dann sei das etwas leichter gefallen. Am Gründonnerstag war es Brauch, dass Menschen Wasser aus Brunnen in die Kirche mitbringen, das dann als „geheiligtes Wasser“ gesegnet wurde. Kinder brachten dann das Wasser mit nach Hause und der Hausvater besprengte damit die Hauswände. Dies sollte dem Haus und der Familie Segen bringen. Auch sollte es dann viel „grünes Essen“ geben. „Das verspricht immer genug Geld, Schutz vor Krankheiten, insbesondere Fieber, Heiserkeit und Müdigkeit.“
Am Gründonnerstag gelegte Eier beflügelten schon immer die Phantasie im Brauchtum. „An diesem Tag gelegte und verzehrte Eier sollten den Bartwuchs fördern. Doch dabei gab es ein Problem: Das gilt für beiderlei Geschlecht. Und wer ein solches Ei über das eigene Haus werfen konnte, ohne dass es auf dem Dach zerklatschte, tat etwas für den Schutz vor Blitzschlag.“ Dieser Brauch stamme aus dem benachbarten Sachsen, doch sei vieles im religiösen Brauchtum regions- und grenzüberschreiend.
Besonderes Augenmerk wurde nach Roßners Worten in der Karwoche auf die Stille und das Zurückstellen nicht unbedingt nötiger Arbeit gelegt. „Wirtshäuser sollten gemieden werden, weil sonst die Seele Schaden nimmt. Finger- und Zehennägel galt es am Karfreitag zu schneiden, weil sie dann nicht mehr brüchig werden sollten. Und vor Sonnenaufgang an diesem Tag von fließendem Wasser zu trinken, bot Schutz vor Zahnschmerzen.“
Doch für Karfreitag hatte Roßner noch mehr Bräuche ausfindig gemacht. Wer den obligatorischen Fisch mit der Familie verspeiste, sollte die Überreste einbinden und auf dem Feld verstreuen. „Damit wurde die Saat vor Wildverbiss geschützt.“ Im Blick auf die Feiertagsruhe am Karfreitag machte Roßner auch deutlich: „Heute ist das Hauptproblem der Egoismus, dass unsere Gesellschaft bisher allgemein anerkannte Werte mehr und mehr vergisst. Man muss nicht am Karfreitag umziehen.“
Auch für den Ostersonntag konnte Roßner manchen Befund an Brauchtum berichten. Von Mädchen vor Sonnenaufgang geholtes und schweigend nach Hause gebrachtes „Osterwasser“, das die Familie dann schweigend trank, sollte ebenfalls Heilkraft bieten, ein „Osterumgang“ um die eigenen Felder Gedeihen der Saat und Früchte befördern. Abschließend hielt Adrian Roßner fest: „Solche Bräuche helfen christlich und mit der Natur als Werk des Schöpfers zu glauben. Viele Menschen haben den direkten Kontakt zur Schöpfung heute völlig verloren. Das Brauchtum kann helfen, diesen Bezug wieder herzustellen.“
 selb-live.de - Presseinfo Evang. Kirchengemeinde Erkersreuth
selb-live.de - Presseinfo Evang. Kirchengemeinde Erkersreuth